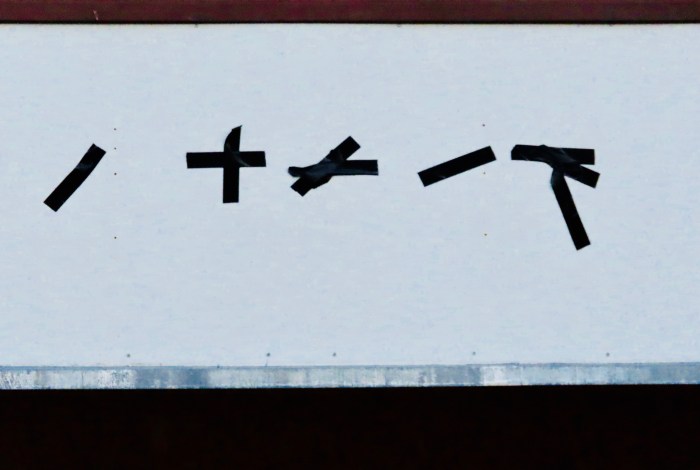Gute Nacht Hase. Allen einen guten Start in die neue Woche!
Gegen den Strom schwimmen
Gestern war zum Beispiel so ein Tag. Schon beim Aufstehen hatte ich das Gefühl, nach Kräften rudern zu müssen, um überhaupt aus dem Bett zu kommen. Nicht, dass ich unausgeschlafen gewesen wäre. Es ging mir gut. Aber jede kleinste Anstrengung verbrauchte – zumindest gefühlt – Bärenkräfte.
Was tun? Mittags fühlte ich mich, als hätte ich einen 16-Stunden-Tag hinter mir. Jeder einzelne Muskel war bleischwer und im Kopf Nebel und Trägheit. Nicht mal Kaffee konnte was ausrichten. Am Liebsten hätte ich mich hingelegt und die Decke über den Kopf gezogen. Ein Gedanke wurde immer lauter: Das bringt doch nix! – Und ja, für einen kurzen Text habe ich so lange gebraucht, wie sonst für drei (und natürlich musste ich ihn heute Morgen als Erstes noch mal umschreiben). Alle Anfragen haben mich genervt statt gefreut. Jeder Anruf war einer zu viel. Und dann?
Doch, ich habe mein Tagespensum am Ende geschafft, und sogar noch mit einer sensationellen Linsensuppe gekrönt. Und: Nein. Es hat nicht keinen Sinn. Auch ein Text ist mehr als keiner. Wenn ich an so einem Tag einknicke, so, zumindest meine Einschätzung heute, werde ich beim nächsten und übernächsten Mal vielleicht zu früh die Pausentaste drücken. Nichts gegen Pausentasten! Aber zu früh auszusteigen, erholt oft nicht, sondern macht schlapp und schlapper. Und das werde ich in den nächsten Jahren ganz von selbst. Also: Weiterschwimmen.
Ecce homo
Gerade steigt mir das Fernweh zu Kopf. Letztes Jahr um diese Zeit habe ich meinen ersten Tag (im Moment noch meine erste Nacht) in New York verbracht, von wo ich dann gut eine Woche später mit dem Auto Richtung Kalifornien aufgebrochen bin.
Es ist ein komischer Mechanismus, der bei mir immer greift nach großen Reisen: Ein Jahr später, meist sogar am Abreisetag, erfasst mich Melancholie und Sehnsucht. Ich lebe quasi die Reise noch einmal durch, oder zumindest die Momente, an die ich mich (auch dank der Fotos) erinnern kann.
Sehr typisch für mich (wie ich rückblickend denke), dass mein erster Besuch mich ins American Folk Art Museum führte. Äh, nee, mein allererster Besuch ging in eines der umliegenden Kaffee+Törtchen-Paradiese (Paradies im Plural klingt ganz schön blöd, ist wahrscheinlich eine Kaffee+Törtchen-Paradies-Kette…) Folk Art, ins Deutsche etwas unglücklich als „naive“ Kunst übersetzt, ist mir ein wichtiger Spiegel geworden. Weil hier Werke von Menschen gezeigt werden, die keinerlei Ausbildung hatten, sich dennoch zum Malen oder Bildhauern (oder und, und, und) berufen fühlten. Die also nicht mit Kniffen, sondern unverstellt und nach ihren Möglichkeiten (wobei das gleich zu einschränkend klingt – eher nach ihren Improvisationstalenten) vorgingen. Es ist mein persönliches „Ecce Homo“-Erlebnis, das sich bislang – trotz mittlerweile häufigerer Besuche solcher Museen – noch nicht abgeschwächt hat. In New York hat mir der Besuch den Menschen und die Menschen einmal mehr als Wunderwesen und äußerst unbekannte Spezies vorgestellt. Mich zum Lachen gebracht und mir – für die nächsten Tage, die ich allein verbringen sollte – Mut gemacht: Du bist nicht allein, flüsterten sie, und gleichzeitig: Das Los des Menschen ist nun mal, dass er oder sie König und Königin im eigenen Land bleiben, allein auf ihrem Thron.
Der Besuch erwies sich als guter Start. Stunden später saß ich dann im spektakulären Restaurant des New Yorker MAD (Museum of Architecture and Design), wo es natürlich erst mal Törtchen gab. Das wirklich ebenso spektakuläre Törtchen habe ich damals schon gepostet, jetzt gibt es die beglückende Aussicht dazu (und ja, die Wolkendecke brach später noch auf und tauchte die Stadt in touristentaugliches Oktoberlicht…) – der Trump-International Hotel-Tower bleibt natürlich hässlich, was für eine Idee, so einen finsteren Riegel vor die sich anschließende Reihe verrücktester Park-Häuser zu stellen…

Fit und modisch durch den Herbst…
So titelt eine Werbemail, die ich vor wenigen Minuten bekommen habe. Noch so ein Moment, in dem ich mich frage, ob ich noch in der Realität meiner Umwelt unterwegs bin. – Geschenkt, Werbung ist immer Post von einem fremden Planeten. Aber gerade stößt sie mir besonders bitter auf…
Armut
Natürlich will niemand frieren. Oder im Winter unter einer dünnen Schneedecke aufwachen – wie es in solchen Dachgeschossen auf dem Land durchaus üblich war. Andererseits: Wie viel Luxus brauchen wir? Wie weit sollten wir uns (meist, wie wir verstanden haben, auf Kosten anderer) auf der Welt ausbreiten? Nein, ich werde keinem anraten, ab Oktober einen dicken Pulli anzuziehen, statt zu heizen. Jede und jeder soll die eigene Zimmertemperatur selbst bestimmen können. Aber ich verstehe, dass ich hin und wieder den dicken Pulli tragen kann. Um Rücksicht zu nehmen.
Drei
sie ist natürlich, ungerade, und die erste Primzahl, die uns beim Zählen von der Eins an begegnet. Drei sind eine/r zuviel, heißt es im Pärchenuniversum, die dritte Lösung kann nach der erstbesten und der zweiten die beste sein. Tatsächlich denke ich gerade über die Drei nach. Als Schlüssel für viele Fragen. Oder zumindest als Weichenstellerin für eine erfolgversprechende Richtung. Entweder/Oder führen oft zu nichts. Man verbeißt sich bloß in eine Konfrontation. Wo die Drei ist, bekommt man wieder Bewegungsspielraum. Drei Menschen sind die kleinste Gruppe, in der bei einer Abstimmung eine absolute Mehrheit den Ausschlag für eine Entscheidung geben kann. Und, drei entscheiden sich schneller als zwei. Wenn das mal kein Argument ist…
Wahrscheinlich
können Menschen einfach nicht viel Realität aushalten. Und das Gedächtnis ist auch nicht besonders gut.
Ein Engländer in New York
David Bowies Einschätzung seiner 2. Heimat aus dem Jahr 2002:
Aus einem Gespräch mit dem Dogma-Filmer Thomas Vinterberg (das gesamte Interview ist auf YouTube zu sehen und zu hören). Zum Weiterhören: David Bowie „I am afraid of America“. In New York, wo er bis zu seinem Tod lebte, fühlte Bowie sich sehr wohl. Es war die kosmopolitische Atmosphäre, die er dort über alles schätzte. Und die sich bis heute bewahrt hat.
Kreise ziehen
Oder wenn es „rund geht“. Dieses Jahr habe ich die Jahreszeiten viel deutlicher erlebt, als alle Jahre zuvor. Vielleicht ist es Einbildung, aber mir scheint, ich stehe dadurch mehr im Leben. Zeit ist vielleicht – so mein Verdacht – kein Strahl, ein in die Zukunft sausender Pfeil. Sondern eben: ein Zyklus. Es könnte ein Trost beim Altwerden sein, denn der Kreis schließt sich irgendwann. Etwas, was einem Zeitstrahl nie und nimmer gelingen kann. Ich setze ab jetzt auf eine neue Karte.
P.S.: In der Silvester-Nacht, als ich meinen Kalender für dieses Jahr gemacht habe, scheine ich schon so Ahnungen gehabt zu haben:

Demut
Natürlich schreibt er gut (er lässt sich Zeit), tatsächlich ist er (wenn man je überhaupt etwas ist) gar kein Schriftsteller, sondern Journalist, seit Jahren hat er „sein“ Thema (ich in der Welt), es gibt also Gründe (zumindest, wenn man welche sucht). Aber dass mich ein Buch so trifft, dass ich schon vor der Hälfte anfange, ganz langsam zu lesen, damit es nicht so schnell mit dem Lesen vorbei ist, geht mir selten so. Und dieses Jahr bislang nur mit diesem einen: Heimkehr, von Wolfgang Büscher.
Vielleicht liegt es daran, dass meine Lieblingserzählung die meines Vaters auf meine Frage war: Was würdest Du machen, wenn Du ganz alleine im Wald leben müsstest? Vielleicht daran, dass Wolfgang Büscher ungefähr in meinem Alter ist, und Dinge erlebt, die sich ähnlich, wenn natürlich anders, in meinem Leben so abspielen. Vielleicht aber auch daran, dass ich mein Leben lang männliche Biografien als Sehnsuchtswege für mein eigenes Fortkommen betrachtet habe, unbewusst natürlich, und mit vorhersehbaren Kollateralschäden (ich denke darüber gerade viel nach, nicht als „Fehlleitung“ oder Scheitern, sondern als eine bis hierher unbewusste Spur, die mich möglicherweise näher zu meinen Idealen und zu meinem Selbstverständnis bringt.
Das Wort, das sich für mich aus dieser Lektüre herauskristallisiert, heißt „beiläufig“. Genau erklären kann ich das noch nicht. Aber es wäre eine positive Beschreibung dessen, wie Leben für mich in einer besten Form zu leben wäre.