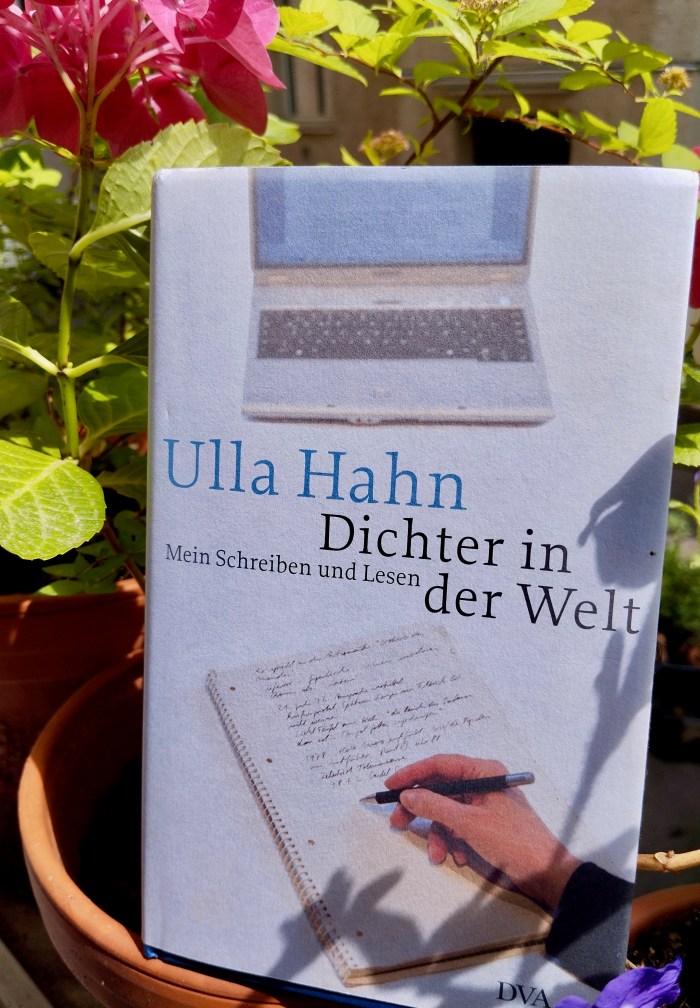Wenn ich sage, dass es eine Zeitreise war, mag der Begriff im ersten Moment verwirren. Weil wir bei dem Wort unwillkürlich an die Reise in eine andere Zeit denken, gerne an die Kindheit, wenn es sich um eine Reise in die Heimat handelt.
Aber es war ganz anders. Allein schon, weil ich mit der Bahn gefahren bin. Und ich mich bereits bei der Anreise wegen der Verspätung auf Dauer einstellen konnte. Haha. Nee. Soll gar kein schlechter Witz sein, sondern von dem allgemeinen Zeitverständnis berichten. Denn natürlich ist es blöd, zu spät zu kommen. Gerade, wenn eine/r einen Anschlusszug gebucht hat (aber wie schön, wenn der dann auch gehörig Verspätung hat…). Was mir auffiel: Wir sind auf Momente fokussiert. Und, um es noch einen Schritt weiter zu treiben: auf perfekte Momente.
Das war natürlich nur der Anfang. Ich hatte viel Gelegenheit, auf einer geriatrischen Station im Krankenhaus zu sitzen. Dort liegen – unserem Gesundheitssystem zum Spott – auch gesunde Menschen, die auf dem Weg sind zu sterben. Sie liegen da natürlich nicht „richtig“. Sie müssten von der Pflege versorgt werden. Die aber, überlastet wie sie ist, manchmal nicht alle gleich aufnehmen kann.
Den eleganten Bogen für einen Text zu schlagen, ist für mich gerade noch zu früh. Deshalb mag meine Beschreibung hier noch fahrig wirken. Dennoch hatte ich plötzlich den Eindruck, dass wir groß darin sind, perfekte Momente anzustreben und auch zu realisieren, aber eher schlecht darin, Dauer zu gestalten, geschweige denn, zu denken oder auszuhalten. Ein gelungener Alltag hat geschmeidig zu sein, da muss es reibungslos flutschen. Ein Termin folgt auf den nächsten, abends wird alles zufrieden abgehakt.
Was aber mit drei Stunden Wartezeit machen? Was mit endlosen Besuchen im Krankenhaus, wenn der Patient entkräftet schläft und der Mann im Nachbarbett vor Verzweiflung schreit? Was ist mit Schmerzen, die einen tagelang plagen, ohne dass eine Tablette Linderung verschafft? Was mit einer kaputten Warmwassertherme, die für nix in der Welt repariert, geschweige denn, ersetzt werden kann? Was mit schlaflosen Nächten? Was (und auch das kann plötzlich eine Herausforderung sein) mit einem ganzen freien Tag?
Wenn wir auf den Bildschirm schauen, sehen wir Momente. Geschenkt: Die Werbung verkauft nur so etwas. Aber natürlich können auch Filme eher Momente einfangen denn Dauer. Wer will schon tagelang im Kino sitzen. Insofern sind wir auf Momente gepolt. Ohne umgekehrt viel Gelegenheit zu haben, Dauer zu erfahren. Am ehesten vielleicht noch mit einem Haustier. Mit dem Erlernen von Etwas, sei es ein Instrument, eine Sprache oder sonst eine Fertigkeit. Schon die Fähigkeit ein langes Musikstück still sitzend in einem Konzertsaal zu hören, bröselt gewaltig. Konzerte in der Berliner Philharmonie schrumpfen seit Jahren. Es gibt mittlerweile häufig Abende, die gerade mal 85 Minuten dauern. Nicht mal eine Schul-Doppelstunde.
Was mir also durch den Kopf ging: Wir denken möglicherweise mehr in Momenten, denn in Dauer. Und das scheint mir ein dicker Fehler zu sein. Weil ein Leben auf Dauer angelegt ist. Nichts gegen perfekte Momente. Aber was ist mit dem Rest? Zeiten, die sich nicht in Momente konfektionieren lassen. Die durchlebt, im schlimmeren Fall durchgestanden werden müssen? Was denkt Ihr? Sehe ich zu schwarz und weiß? Oder übersehen wir die meiste Zeit tatsächlich etwas?