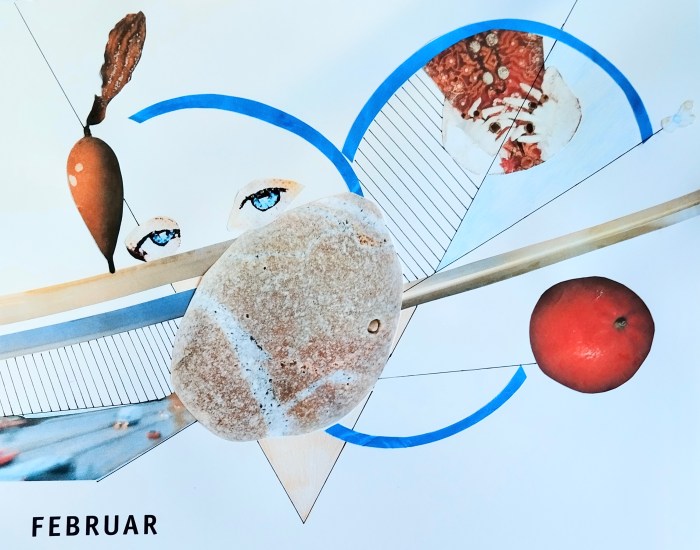Ich musste in die belgische Stadt Löwen fahren, um zum ersten Mal welche zu sehen und gleich auch zu probieren. Seebananen sind ein ungeheuer saftiges Gemüse. Es wächst am Strand, ursprünglich nur in Australien, mittlerweile aber auch bei Züchter*innen, die das knackige, leicht salzige Grün für ca. 8,00 € pro 150 Gramm verkaufen. Und ja. Die Frage, of das sein muss, vor allem, wenn man sich hauptsächlich mit saisonnalen und regionalen Zutaten beschäftigt, liegt einem sicher schnell auf der Zunge. Deshalb hole ich ein bisschen aus:
Kochen und Essen sind bekanntlich Kulturtechniken. Auch wer nur gelegentlich (und gerne) essen geht, mag im Laufe des Lebens auf diese Weise einige kulinarische Höhepunkte erleben. Und Köch*innen kennenlernen, die etwas von ihrem Handwerk verstehen, und die Gerichte so ausbalancieren, dass sie entweder wie die beste Variante eines bekannten Rezepts daherkommen oder aber so neu und überraschend sind, dass es einem schier dem Atem verschlägt.
Und wer jetzt denkt: „na klar, nehme ich halt Kohlrabi und Seebanane, da werden die Gäste schon staunen“, macht es sich zu leicht. Denn so einfach ist es mit dem Kochen und dem kulinarischen Kombinieren dann doch nicht.
Ich bin kein Foodie, und obwohl ich gerne esse, habe ich wenig gastronomisches Wissen. Tatsächlich war ich in Löwen zum ersten Mal bei einem Sternekoch, der die Molekularküche beherrscht und regional kocht. Mag also sein, dass mich der Zauber des Ersten Mals gepackt hat. Aber ich kann sehr klar sagen, dass es mir geschmeckt hat. Und das ist für eine Gastro-Kritik, egal wie rudimentär sie ist, sicher der wichtigste Punkt.
Und es nicht nicht mal nur gut geschmeckt: es war ein äußerst vergnügliches Essen zusammen mit einer Kinderfreundin, mit der ich schon als wir noch ganz klein waren, am liebsten Süßigkeiten geteilt habe. Nein! Keine Erlebnisgastronomie! Das Restaurant, in dem wir saßen (obwohl wir nicht reserviert hatten!) ist von einer Gastfreundschaft, die rar ist.
„Taste“ heißt es, ein mit sicherer Hand durchaus freestyle eingerichtete Lokal, gemütlich UND cool, dezent UND schräg. Hier kocht der Sternekoch Bart Tastenhoye selbst mit zwei Kollegen für alle sichtbar in der Restaurantküche, kongeniale Gastgeberin ist seine Frau Dorotee Hoste, die mich vom ersten Moment an vergessen ließ, in einem Nobelrestaurant zu sein, und vielleicht nicht alle Geflogenheiten solch elitärer Orte parat zu haben.
Gekocht werden hier pro Abend zwei Menues, ein vegetarisches und eins mit Fisch und Fleisch (die Karte wechselt in etwa jeden Monat). Man kann zwischen vier und sechs Gängen wählen, dazu gibt es vorab ein Amuse Gueule, ein kleines frisches Brot mit Butter, Salz und Pfeffer und nach dem Nachtisch noch ein paar süße Kleinigkeiten UND noch ein kleines Eis, das der Chef selbst an den Tisch bringt.
Die einzelnen Portionen sind wie kostbare Tableaus angerichtet, und jetzt, wo ich solche Kunstwerke erstmals selbst probiert habe, muss ich wirklich sagen, dass sich jedes einzelne Blättchen lohnt. Klar, ich liebe Pommes, und (haha!), Bart Tastenhoye liebt sie auch und geht gelegentlich mit Kaputze auf dem Kopf in eine etwas abgeranzte Bude, wie seine Frau mir beim Abschied lachend erzählt. Das heißt, Gourmetküche ist vermutlich nichts für den Alltag, oder für den Alltag der meisten Menschen, aber sie ist etwas Wundervolles, wie Oper oder jedes andere besondere Konzert, das man sich nur gelegentlich, aber dann mit großer Freude gönnt.
Was nun Kohlrabi und Seebanane angeht. Nein, sie müssen keineswegs zusammen auf dem Teller landen. Aber wer Kohlrabi liebt, wird sich freuen, wie überraschend neu sie zusammen mit den exotischen Kollegen harmoniert. Kohlrabi fühlt sich dabei für mich wie ein geliebtes Kindheitsgemüse an, das erdig und winterlich schmeckt, während die Seebanane daneben frisch wie eine Zitrusfrucht, dabei aber salzig explodiert, wenn man auf sie beißt. Und auch hier gilt: Das muss ich jetzt nicht in meinen eigenen Küchenplan integrieren. Aber sie harmonieren perfekt wie ein Sonnenuntergang über einem See in den Bergen, den ich so auch nur einmal im Leben sehe und nie wieder vergesse.
Restaurant TASTE
Naamsestraat 62
3000 Leuven
016/84.87.32
Reservations: reservations@leuventaste.be
General: info@leuventaste.be
Invoicing: invoices@leuventaste.be
Montags geschlossen